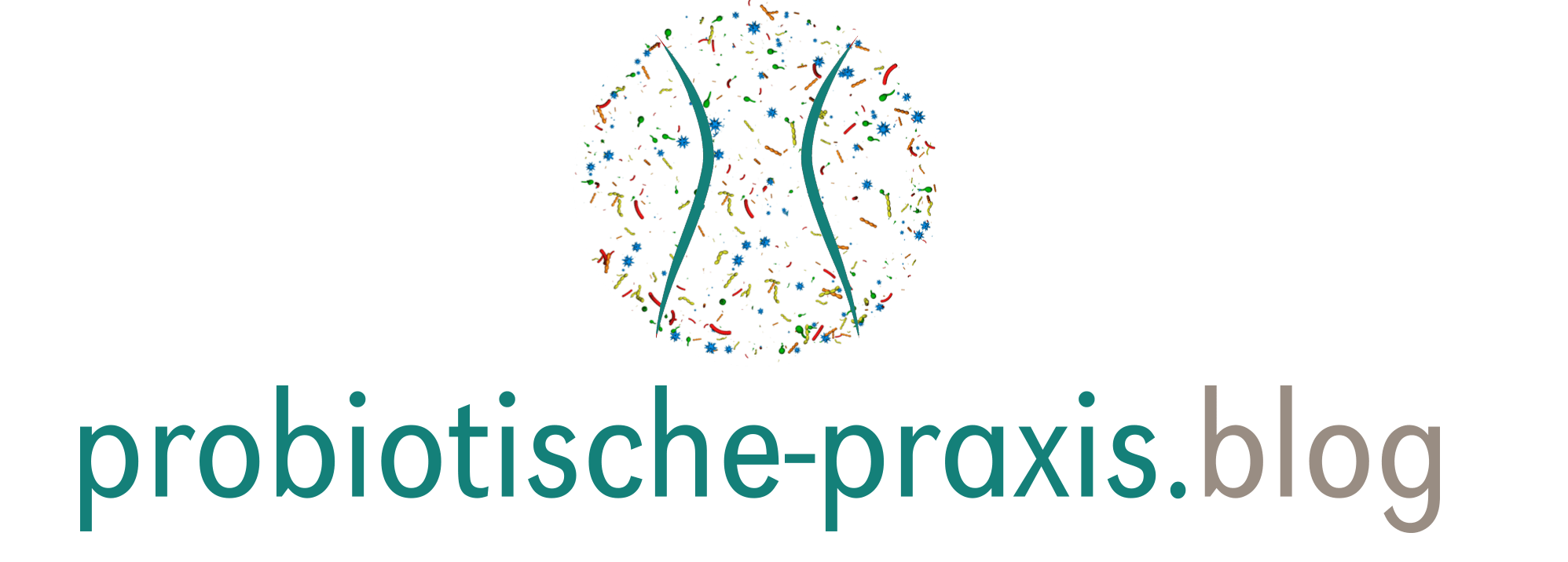„Wenn einer eine Reise tut,“ … denkt er an mögliche Erkrankungen des Verdauungstraktes zuletzt. Dabei wäre es so einfach, neben der Sonnenschutzcreme auch einen „Aufpasser“ für den Darm einzupacken. Damit der Erholung nichts im Wege steht!
Der Winter rückt immer näher, da zieht es viele unserer Zeitgenossen in den Süden – wenn auch nur für eine oder zwei Wochen. Wenn ich daran denke, kommt mir unweigerlich wieder eine Patientin in den Sinn, die im letzten Jahr mit ihrem Mann in Ägypten Zuflucht vor der Kälte und dem grau verhangenen Himmel in der Heimat gesucht hatte. Für Kathleen* (46) war es keine so schöne Erinnerung:
Vor Ort ereilte sie, wie etliche andere in ihrer Reisegruppe auch, eine ordentliche Magen-Darm-Grippe (Gastroenteritis) – eine typische Reiseinfektion.
Das ist natürlich besonders unangenehm, wenn es im Urlaub passiert, von dem man sich eigentlich Erholung erhofft hatte. „Mir ist das so genau in Erinnerung geblieben,“ erzählte Kathleen, „weil ich seit diesem Urlaub praktisch ständig Bauchbeschwerden habe mit Verstopfung und Durchfällen im Wechsel, und entsprechend unwohl fühle ich mich. Und das, obwohl ich vorher nie Probleme mit meiner Verdauung hatte!“
Heilige Mikrobiota! So einen Urlaub kann man echt knicken
Sie hatte mein volles Mitgefühl. Unter „Mitbringsel aus dem Urlaub“ versteht man schließlich etwas völlig anderes. Anfangs dachte sie wohl noch, es seien die Nachwirkungen der Magen-Darm-Grippe, aber als es im Verlauf einfach nicht besser wurde, ging sie doch zum Arzt. Und bei EINEM Arztbesuch sollte es nicht bleiben …
Nicht, dass ich zum ersten Mal über eine derartige Grippe berichten würde. Wenn Sie sich jetzt zum Winter vor einer Gastroenteritis schützen wollen, empfehle ich Ihnen dies zur Lektüre:
Nach mehreren Untersuchungen inklusive Darmspiegelung (die die Symptomatik noch weiter verschlechterte), einer Stuhlprobe und vielen Gesprächen, kam es zu der Diagnose eines postinfektiösen Reizdarmsyndroms (PI-RDS), mit der sich Kathleen im Weiteren allerdings allein gelassen fühlte, was sie letztlich zu mir führte.
Überraschung gelungen
Ich war positiv überrascht, dass die Diagnose schon stand, weil die wenigsten Mediziner dies „auf dem Schirm haben“. Auch ist es ein weiter Weg dorthin, weil das postinfektiöse Reizdarmsyndrom eine Ausschlussdiagnose ist, sprich: Die Beschwerden werden als solche erst dann klassifiziert, wenn alle anderen möglichen Ursachen wie z. B. chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder weiter bestehende infektiöse Ursachen ausgeschlossen werden konnten.
Natürlich habe ich das „normale“ Reizdarmsyndrom auch schon mal beschrieben:
Die Symptomatik ist leider eher unspezifisch.
Mögliche Anzeichen eines RDS
- Durchfälle oder Verstopfung (auch im Wechsel)
- Blähungen
- Bauchschmerzen
- häufiger Stuhldrang
- Unwohlsein
- Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten
- Viszerale Hypersensitivität (die Bauchorgane betreffend)
- Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung
Das Reizdarmsyndrom zählt zu den funktionellen Verdauungsstörungen. Es gibt also kein organisches Korrelat für die Beschwerden, d. h. bei einer Magen-/Darmspiegelung ist meist nichts Auffälliges zu erkennen. Dennoch ist es eine ernstzunehmende Diagnose.
Früher wurden solche Beschwerden gern auf die Psyche geschoben, und dies passiert zum Teil leider auch heute noch, doch hat die Wissenschaft längst gezeigt, dass es eine „echte“ Erkrankung ist.
Speziell das PI-RDS entsteht wie bei Kathleen nach einer Magen-/Darm-Infektion, häufig nach einer Reise-Infektion mit z. B. Campylobacter, Shigellen, Yersinien oder Salmonellen. Speziell Länder im Nahen Osten und in Südostasien sind bekannt dafür, derartigen Reisedurchfall zu verursachen.
Die Salmonellen müssen raus, aber zackig!
Der Körper scheidet die Salmonellen relativ schnell aus – durch teils heftigen Durchfall. Der sollte auch nicht mit synthetischen Opioiden wie Loperamid gestoppt werden! Die Salmonellen müssen raus, und das schnellstmöglich.

Es gibt ein paar Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des PI-RDS im Anschluss an eine Gastroenteritis erhöhen, dazu zählen:
- weibliches Geschlecht
- jüngeres Alter
- schwerer Krankheitsverlauf
- psychische Vorbelastung wie z. B.
Angststörung oder Depression
Rund 10-20% der Patient:innen entwickeln nach einer Gastroenteritis ein Reizdarmsyndrom. Der genaue Pathomechanismus ist noch nicht endgültig geklärt. Es wird vermutet, dass die Infektion die Darmbarriere, Motilität, Viszeral-Sensitivität und die Mikrobiota nachhaltig schädigen kann.
Man geht davon aus, dass nach der Infektion noch länger eine Entzündungsreaktion im Darm bestehen bleibt. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass durch die akute Erkrankung die Barrierefunktion des Darms gestört wird. Insbesondere Yersinien lagern sich langfristig in der Darmschleimhaut ab. Durch das permanent aktive Immunsystem verdickt die Schleimhaut, und es kommt zu einer kollagenen Colitis. Was davon zu halten ist, können Sie hier nachlesen:
Ein anderes Phänomen ist die Entstehung eines Leaky-Gut-Syndroms nach einer Reiseinfektion. Zwischen den einzelnen Darmzellen befinden sich sogenannte tight junctions, die gewährleisten, dass nur Nährstoffe und Elektrolyte in die Zellen aufgenommen werden, während Toxine „draußen“ bleiben. Entzündungszellen und Toxine, die von manchen Bakterien freigesetzt werden, können diese Barriere aber angreifen und auflockern. Dadurch entsteht ein durchlässiger Darm.
Mehr zum Leaky-Gut-Syndrom:
Der Teufelskreis eines Leaky Gut
Die Folge ist, dass Entzündungsmediatoren und Giftstoffe nun in die Zellen der Darmschleimhaut aufgenommen werden und dort weitere Entzündungs-, aber auch Schmerzreaktionen verursachen. Ab dem Punkt befindet man sich in einem Teufelskreis.
Erschwerend kommt hinzu, dass eine Infektion des Magen-Darm-Trakts in den meisten Fällen zu einer fortbestehenden Dysbiose führt, so dass die typischen Symptome wie Blähungen oder Durchfälle entstehen können.
Kathleen gab zu, dass sie zwar schon im Internet dazu recherchiert hätte, aber so richtig das Thema bisher noch nicht durchdringen konnte. Immerhin schien sie jetzt meinen Ausführungen folgen zu können. Weil ich davon ausging, dass Kathleen auch schon einige Dinge probiert hatte, um ihre Symptome zu lindern, wollte ich von ihr hören, wo ich möglicherweise anknüpfen konnte.
„Bei schlimmen Bauchschmerzen mache ich mir meist eine Wärmflasche, das schafft dann wenigstens kurz Linderung“, begann Kathleen ihre Aufzählung. „Außerdem versuche ich natürlich, mich möglichst ausgewogen zu ernähren. Nicht zu viele Kohlenhydrate, so dass die Blähungen nicht so stark sind. Milch vertrag’ ich seit der Infektion auch nicht mehr so gut, die lasse ich also auch weg.“

Glücklicherweise gibt es einige Milchalternativen wie z. B. Hafermilch, die keine Laktose enthält. Dass eine Laktoseintoleranz nach einer Gastroenteritis neu auftritt, ist gar nicht so selten, weil sich jenes Enzym, das die Laktose spaltet und somit verdaut, in den Dünndarmzotten befindet. Bei einer Magen-Darm-Grippe werden die Zotten so angegriffen, dass die Laktosespaltung danach eingeschränkt sein kann.
Grundsätzlich war Kathleen auf dem richtigen Weg, denn gerade mit der Ernährung lassen sich die Symptome zumindest lindern. Beim Reizdarmsyndrom hat sich die low FODMAP-Ernährung etabliert. Hier geht es darum, kurzkettige Kohlenhydrate in dem Rahmen zu reduzieren, wie sie einem erfahrungsgemäß nicht zuträglich sind.
Was anfällig macht für Blähungen
FODMAP steht für Fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide and Polyole, und gerade das F zeigt, warum diese ein Problem darstellen: Sie sind schlechter verdaulich, fermentieren deshalb, gären also im Darm und führen bei anfälligen Personen zu Blähungen. Außerdem verschieben sie Zellflüssigkeit in Richtung des Darmlumens, was Durchfälle fördert.

Kathleens Mienenspiel zeigte mir, dass sie sehr bei der Sache war. Entsprechend willig nahm sie den Hinweis auf, dass man bei dieser Ernährungsform zunächst für einige Wochen komplett auf FODMAP-reiche Lebensmittel verzichtetund dann schaut, ob sich die Beschwerden bessern. Dann können die verschiedenen Gruppen langsam nach und nach wieder hinzugenommen werden, um zu testen, ob und in welchen Mengen diese Lebensmittel vertragen werden.
Ziel ist es, nur solche Lebensmittel wegzulassen, die man auch wirklich nicht verträgt. Viele meiner Patient:innen fahren damit sehr gut.
Zu den Oligosacchariden zählen aber auch einige Gemüsesorten, die durchaus wichtig für unseren Körper und unser Darmmikrobiom sind, z. B. Hülsenfrüchte, Lauch und Zwiebeln oder Chicorée. Diese Nahrungsmittel liefern wichtiges Futter für unsere Darmbakterien, weshalb eine Darmsanierung in Kathleens Fall auch so wichtig ist, damit auf lange Sicht „gute“ FODMAPS wieder vertragen werden.
Meiner Patientin empfahl ich daher das Multispezies-Probiotikum OMNi-BiOTiC® Reise, kombiniert mit OMNi-BiOTiC® 10. „Aber meine Reise liegt doch schon so lange zurück“, wandte Kathleen ein. Da hatte sie zweifellos recht, aber wenn nach einer Reiseinfektion ein Reizdarm entsteht, ist die nach wie vor schwellende Infektion mit z. B. Yersinien – wie oben beschrieben – in den meisten Fällen die Ursache.

Nach meiner Erfahrung mit ungezählten Reizdarm-Patient:innen ist da die Kombination aus OMNi-BiOTiC® REISE morgens und OMNi-BiOTiC® 10 am Abend für rund drei Monate ideal, um pathogene Keime wie z. B. Yersinien endgültig zu verdrängen und vor allem die Toxine zu eliminieren!
Dazu habe ich Kathleen die Einnahmen von META-CARE® Colon Lecithin empfohlen – zur Versorgung stark beanspruchter oder geschädigter Darmschleimhaut und somit zur Unterstützung der Barrierefunktion des Darms.
Außerdem die Urtinktur Ceres Mentha piperita, die krampflösend wirkt und gerade bei Blähungen, Krämpfen, Übelkeit und Magen-Darm-Entzündungen sehr gut eingesetzt werden kann.
Sehr wahrscheinlich würde Kathleen auch MYRRHINIL-INTEST® helfen. Dieses pflanzliche Arzneimittel aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle wird seit mehr als 60 Jahren erfolgreich bei Magen-/Darm-Störungen zur Linderung von Durchfällen, Bauchkrämpfen und Blähungen eingesetzt.
Falls Sie jetzt einen Urlaub in sonnigen Gefilden planen, wünsche ich Ihnen schon jetzt eine erholsame Auszeit. Denken Sie daran, die „richtigen Freunde“ mitzunehmen – und nur mit Ihren eigenen auch wieder nach Hause zurückzukehren!
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich Ihre
Dagmar Praßler
* Name geändert
Titelbild: © Satyrenko / shutterstock
Postinfektiöses Reizdarmsyndrom
In meinem Blog beschreibe ich regelmäßig Erfahrungen aus meiner Praxis, insbesondere den Verlauf einiger konkreter Behandlungen. Ich weise darauf hin, dass die beschriebenen Verläufe Einzelfälle sind und keine allgemein verbindlichen Rückschlüsse daraus gezogen werden können. Andere Menschen können anders reagieren, auch wenn sie die gleiche Behandlung erfahren. Neben den von mir beschriebenen Produkten gibt es fast immer auch weitere von anderen Herstellern.
Es handelt sich in den Beschreibungen um meine subjektiven Wahrnehmungen, ein Heilversprechen ist darin nicht zu sehen. Bei Beschwerden sollten Sie grundsätzlich ärztlichen Rat oder den einer Heilpraktikerin / eines Heilpraktikers einholen.
Im Wechsel zu den Berichten aus der Praxis widme ich mich hier aber auch (unter dem Rubrum „News“) aktuellen Studien, die ich für erwähnenswert halte oder einen direkten Bezug zum Mikrobiom haben. Auch hier handelt es sich ausschließlich um redaktionelle Beiträge.